Fleischgewinnung
Transport, Schlachtung, Klassifizierung und weitere Verarbeitung
Bei der Gewinnung von Rindfleisch kann man zwischen den Schritten Tiertransport, Schlachtung und Klassifizierung unterscheiden.
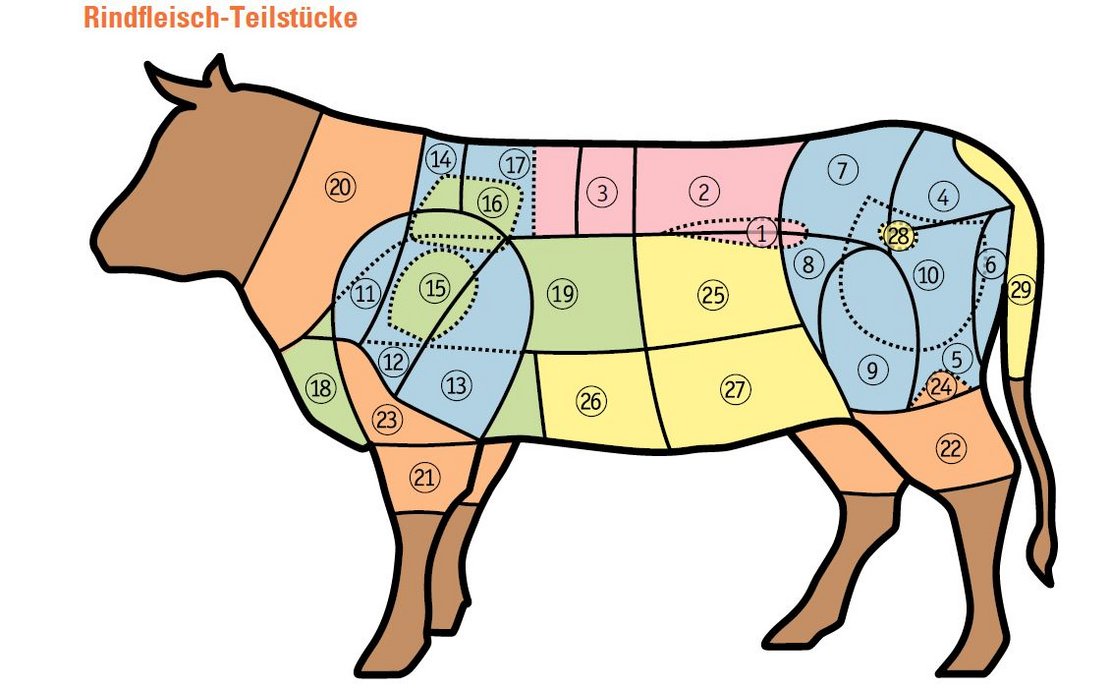 © LK NÖ
© LK NÖ Die EU-Tiertransportverordnung regelt seit 2007 europaweit jene Tiertransporte, die in Verbindung mit einer wirtschaftlichen Tätigkeit durchgeführt werden. Um weitere Details und Zuständigkeiten national zu regeln, wurde das österreichische „Tiertransportgesetz 2007“ erlassen. Die österreichischen Bestimmungen für den Tiertransport zählen zu den strengsten weltweit. Es dürfen nur Rinder in guter körperlicher Verfassung transportiert werden, außerdem muss der Transport stressfrei verlaufen und der Weg bzw. die Dauer sind so kurz wie möglich zu halten. Alle transportierten Rinder müssen gekennzeichnet sein und eine Transportbescheinigung (z. B. AMA Viehverkehrsschein) ist mitzuführen.
Laut BVD-Verordnung muss jedes Rind beim innerstaatlichen Transport von einer Gesundheitsbescheinigung begleitet werden, die vom Empfänger der Tiere mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der Behörde auf Verlangen zur Kontrolle vorzulegen ist.
Bei Transporten über 65 km sind auch ein EU-Befähigungsnachweis für den Transport sowie eine Zulassung als Transportunternehmer erforderlich. Grundsätzlich sollte die Transportzeit zum Schlachthof innerhalb von Österreich max. 4,5 Stunden betragen. Wenn es jedoch aus geographischen, strukturellen Gründen oder aufgrund von aufrechten Verträgen notwendig ist, darf die Beförderungsdauer auf maximal acht oder im Falle von Transporten, bei denen aufgrund kraftfahrrechtlicher Bestimmungen Lenkerpausen einzuhalten sind, auf 8,5 Stunden verlängert werden. Während des gesamten Transports steht das Wohlergehen der Tiere an erster Stelle.
Die Schlachtung ist gemäß der Tierschutz-Schlachtverordnung durchzuführen. Ein respektvoller Umgang mit den Tieren ist prioritär und strenge Hygienemaßnahmen und Gesundheitskontrollen sind einzuhalten. Eine Grundsatzbestimmung der Verordnung sagt etwa aus, dass die Tiere von ungerechtfertigten Schmerzen, Leiden, Schäden oder schwerer Angst, beginnend bei der Anlieferung bis zur Tötung, verschont bleiben müssen. Die Einhaltung dieser Bestimmung gewährleistet nicht nur einen schonenden Umgang mit den Rindern, sondern auch eine hochwertige Fleischqualität. Erreichen die Rinder den Schlachthof, werden sie zuerst im unterteilten Wartestall untergebracht und ihr Gesundheitszustand (Schlachttieruntersuchung) sowie ihre Identität festgestellt. Anschließend folgt die Betäubung mittels Bolzenschuss, die sie empfindungs- und wahrnehmungslos macht. Möglichst rasch danach wird das Rind durch das Durchtrennen der Halsschlagader entblutet. Erst nach vollständiger Entblutung erfolgen die weiteren Schritte: Die Abtrennung der Extremitäten, die Entfernung von Haut und Organen und das Zerteilen in zwei Hälften. Anschließend werden das Fleisch und die Organe aufs Neue von einem Veterinär untersucht und identifiziert sowie von einem behördlich geprüften Klassifizierer klassifiziert und eingestuft.
Die Schlachthöfe unterliegen ständigen veterinärbehördlichen Kontrollen, und neben der fachlichen Qualifikation des Personals garantiert das hohe hygienische Niveau den Konsumenten eine hochwertige Qualität des österreichischen Rindfleisches.
Bei der Klassifizierung erfolgt die Einstufung, Verwiegung und Kennzeichnung der Rinderschlachtkörper durch behördlich geprüfte Klassifizierer. Sie ist genormt durch einheitliche EU-weite Vorschriften und in Österreich durch das Vermarktungsnormengesetz (VNG) geregelt. Die Klassifizierung dient dazu, Schlachtkörperqualitäten miteinander vergleichen zu können und sie bietet Aufschluss für Landwirte, Schlachtbetriebe, Händler und Konsumenten. Außerdem bildet sie mit dem Gewicht die Grundlage zur Abrechnung zwischen Landwirt und Schlachthof.
Zu Beginn wird der Schlachtkörper einer von fünf Kategorien zugeordnet, je nachdem ob das Rind jünger als zwei Jahre und kastriert, älter und kastriert (Ochse) oder nicht kastriert ist, weiblich und bereits gekalbt (Kuh) oder nicht gekalbt (Kalbin) hat. Anschließend werden die Rinderschlachtkörper nach ihrer Fleischigkeit und ihrem Fettgewebe beurteilt. Die Fleischigkeit wird ebenso in fünf Kategorien unterteilt und gibt Aufschluss über den Ausmästungsgrad, das Verhältnis von Fleisch zu Knochen und die Proportionen der Teilstücke zueinander. Es gibt ebenso fünf Fettgewebeklassen, welche Aufschluss über den Verfettungsgrad geben. Dadurch werden ebenso indirekte Aussagen über den Ausmästungsgrad, das Verhältnis Fleisch zu Fett und die Marmorierung des Fleisches ermöglicht.
Nach dieser Form der Klassifizierung muss ein Protokoll angelegt werden, welches die Daten von der Identifizierung des Tieres (Ohrmarkennummer) bis zum Namen des Klassifizierers erfasst und zehn Jahre vom Klassifizierungsdienst aufbewahrt werden muss. Auf dem Schlachtkörper selbst wird ein Etikett mit allen wesentlichen Daten des Tieres und dessen Herkunft angebracht.

Damit Rindfleisch genießbar wird und Zartheit und Aroma sich entfalten, muss es gut abgehangen sein. Direkt nach der Schlachtung wird das Fleisch zäh und erst nach rund 40 Stunden wird es durch eiweißspaltende Enzyme zart und genießbar. Die Dauer der Fleischreifung hängt an sich von Rasse, Geschlecht, Alter des Tieres und Art des Teilstücks ab. Früher musste das Fleisch während der Reifephasen auf Haken hängen, wodurch der Begriff „abhängen“ entstand. Heutzutage wird es zur Reifung in Folie vakuumverpackt und unter festgelegten Bedingungen gelagert. Ob ein Rindfleisch gut gereift ist, erkennt man anhand zweier Merkmale: einerseits an der rotbraunen Farbe, andererseits an einer nicht bleibenden Druckstelle, wenn man es kurz mit dem Finger berührt.

