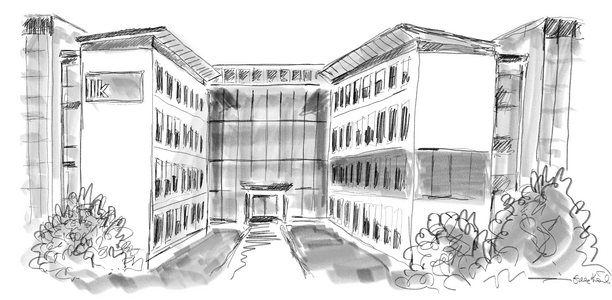Presseaussendungen 2023
Auswirkungen auf die europäische Landwirtschaft
Der Umweltausschuss des EU-Parlaments hat am 24. Oktober 2023 über den Entwurf der Sustainable Use Regulation (SUR-Verordnung) und die Wiederzulassung von Glyphosat abgestimmt. Die Entscheidung bezüglich Glyphosat basiert endlich auf wissenschaftlichen Fakten, was positiv ist. Jedoch ist das Ergebnis der Abstimmung zur SUR-Verordnung besorgniserregend. Johannes Schmuckenschlager, Präsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich, äußert Bedenken hinsichtlich der Versorgungssicherheit in Europa. Er sieht die beschlossenen Maßnahmen als unrealistisch und praxisfremd, da sie die Produktions- und Versorgungssicherheit gefährden.
Kritische Stimmen zur SUR-Verordnung
Der Entwurf zur SUR-Verordnung beinhaltet unpraktikable Vorgaben zur Reduktion von Pflanzenschutzmitteln, umfangreiche Dokumentationspflichten und ein generelles Verbot von Pflanzenschutzmitteln in bestimmten sensiblen Gebieten. Diese Maßnahmen könnten die Landwirtschaft erheblich beeinträchtigen und die Versorgung mit leistbaren, qualitativ hochwertigen Lebensmitteln und nachhaltigen Rohstoffen gefährden. Es braucht dringend eine Überarbeitung des EU-Vorschlags und eine umfassende Folgenabschätzung.
Auswirkungen auf die Landwirtschaft
Ein Beispiel für die negativen Auswirkungen solcher Maßnahmen ist, dass in nur drei Jahren 4.000 Hektar Anbaufläche für Erdäpfel verloren gingen. Grund dafür war der Schädling Drahtwurm. Die aktuelle Abstimmung könnte die Situation noch verschlimmern. Es wird gefordert, dass praxistaugliche Lösungen zur Bekämpfung von Schädlingen wie dem Drahtwurm gefunden werden. Stattdessen werden willkürlich verhängte Verbote gefordert. Die Konsument:innen werden dann am Ende die Kosten tragen müssen, wenn europäische Standards durch Importe aus anderen Ländern nicht eingehalten werden.
Wiederzulassung von Glyphosat
Die Wiederzulassung von Glyphosat wird als Erfolg gewertet, da sie auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert. Die endgültige Entscheidung der EU-Kommission zur Wiederzulassung von Glyphosat wird in den kommenden Wochen erwartet.
Strenge Regelungen in Österreich
In Österreich ist der Einsatz von Glyphosat streng geregelt, sodass Lebens- und Futtermittel nicht mit Glyphosat in Kontakt kommen. Der Einsatz von Glyphosat unterstützt eine bodenschonende Bewirtschaftung und hilft, Erosion, Verschlämmungen und Nährstoffauswaschung ins Grundwasser zu vermeiden. Ohne Glyphosat müsste die Bodenbearbeitung intensiviert werden, was die Erosionsgefahr und den CO2-Ausstoß erhöhen würde.
Download
Kontakt für Rückfragen
Abteilung Agrarkommunikation der Landwirtschaftskammer NÖ
Tel.: +43(0)5 0259 28000, E-Mail: agrarkommunikation(at)lk-noe.at
Bereits 260.000 Kinder auf NÖ Bauernhöfen geschult
Die erfolgreiche Bildungsinitiative „Schule am Bauernhof“ der Landwirtschaftskammer Niederösterreich erweitert ihr Angebot um die heimische Teichwirtschaft.
Erfolg und Erweiterung von „Schule am Bauernhof“
Seit dem Start im Jahr 2000 haben rund 260.000 Schüler:innen in Niederösterreich an etwa 13.000 Führungen teilgenommen. Schulklassen und Kindergärten besuchen Bauernhöfe, um praxisnah das Leben und Arbeiten auf dem Bauernhof kennenzulernen. Dieses Jahr wurde das Programm um die heimische Teichwirtschaft erweitert. Es ist wichtig, dass Kinder den Weg der Lebensmittel und deren Herkunft verstehen, um bewusste Konsumentscheidungen treffen zu können. Jedes Kind sollte mindestens einmal in seiner Schulzeit einen Bauernhof besuchen.
Beeindruckende Zahlen und Lehrer:innen-Ausbildung
- „Schule am Bauernhof“ startet 2000 mit 174 Teilnehmer:innen und 75 aktiven Betrieben.
- Heute gibt es 176 Anbieter:innen, die jährlich rund 1.400 Führungen für etwa 26.500 Kinder anbieten.
Lehrkräfte sollten während ihrer Ausbildung Kontakt zu einem Bauernhof haben. Die Landwirtschaftskammer arbeitet deshalb mit Pädagogischen Hochschulen zusammen, um das agrarpädagogische Angebot in der Schulpraxis zu verankern.
Praxisnahe Führungen und positive Resonanz
Birgit Hofbauer und Silvia Huber, zwei der ersten Teichranger-Absolvent:innen, betonen, dass der Lehrgang theoretisches Wissen und praktische Fähigkeiten zur Erhaltung der ökologischen Vielfalt in Teichen vermittelt und sie auf die Wissensvermittlung bei Schulklassen vorbereitet. Die Volksschule Gmünd hat bereits an einer Führung teilgenommen. Schulleiterin Tamara Masch lobt das Angebot und hebt hervor, dass die Teichführung den Kindern ermöglicht, den Lebensraum Teich und seine Bewohner direkt in der Natur zu erleben.
Über die Initiative „Schule am Bauernhof“
In Niederösterreich öffnen 176 Betriebe ihre Hoftore für junge Konsument:innen. Die Bäuerinnen und Bauern werden in 88 Unterrichtseinheiten geschult und die Höfe auf Kindersicherheit überprüft. Zudem müssen die Schule am Bauernhof-Anbieter:innen jedes Jahr eine verpflichtende Weiterbildung erfüllen.
Download
Kontakt für Rückfragen
Abteilung Agrarkommunikation der Landwirtschaftskammer NÖ
Tel.: +43(0)5 0259 28000, E-Mail: agrarkommunikation(at)lk-noe.at
- Mehr Informationen zu Schule am Bauernhof: www.schuleambauernhof.at
- Mehr Informationen zu Erlebnis Bauernhof: www.erlebnisbauernhof-noe.at
Bäuerinnen NÖ bringen Landwirtschaft in die Volksschulen
Die Bäuerinnen Niederösterreich starten ihre Schulaktionstage und bringen ab dem 16. Oktober die faszinierende Welt der Landwirtschaft direkt in die ersten und zweiten Klassen der Volksschulen. Durch anschauliche und interaktive Unterrichtsstunden ermöglichen sie den Kindern spannende Einblicke in Landwirtschaft und gesunde Ernährung.
Landwirtschaft zum Be-greifen
Die Landwirtschaft soll in die Schule gebracht werden, um den Schülerinnen und Schülern spielerisch den Grundsatz „Lebensmittel sind kostbar“ näherzubringen. Die Kinder sollen auch sehen und schmecken, dass eine selbst zubereitete Jause mit heimischen Lebensmitteln Genuss und Spaß bereitet und die Lebensmittel dafür ganz in der Nähe geerntet werden.Mit buntem Anschauungsmaterial wecken die Bäuerinnen das Interesse der Kinder und schaffen Bewusstsein für regionale und saisonale Lebensmittel sowie die landwirtschaftliche Produktionsweise. Bei der gemeinsamen Jause und dem Verkosten von heimischen Produkten stehen gesunde Ernährung und Genuss im Vordergrund.
Authentische Einblicke in die Landwirtschaft
Möglichst viele Kinder sollen spannende und lehrreiche Einblicke in die Landwirtschaft erhalten. Es gibt keine lila Kühe und auch keine sprechenden Schweine, aber hart arbeitende Bäuerinnen und Bauern, die sorgsam mit ihren Tieren umgehen und unsere täglichen Lebensmittel produzieren. Die Bäuerinnen leisten mit ihren Schulaktionstagen einen wertvollen Beitrag. Ihnen und den Lehrkräften, die dieses Angebot nutzen, wird herzlicher Dank ausgesprochen. Sie schaffen Zukunft für die bäuerlichen Familienbetriebe und fördern einen regionalen, umweltfreundlichen Konsum.
Wissen über Lebensmittelproduktion
Bedeutend sind das Ernährungswissen und das Wissen über die Erzeugung von Lebensmitteln für nachhaltige Konsumentscheidungen. Es ist daher wichtig, den Weg der Lebensmittel und deren Herkunft auch in den Schulen zu vermitteln. Essgewohnheiten würden bereits im Kindesalter geprägt. Die Bäuerinnen und Bauern bieten eine Vielzahl pädagogisch wertvoller Angebote an. Die aktive Auseinandersetzung mit der Landwirtschaft und unseren Lebensmitteln weckt Neugier und Fragen, die die Bäuerinnen bei den Aktionstagen mit ihrem Praxiswissen beantworten können.
Ein fester Bestandteil des Schuljahres
Die Schulaktionstage der Bäuerinnen Niederösterreich sind seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der Aktivitäten der Bäuerinnenvereine und zahlreicher Schulen. Die Aktionstage starten jedes Jahr rund um den Welternährungstag am 16. Oktober und finden das gesamte Schuljahr über statt. Darüber hinaus ergreifen die Bäuerinnenvereine zahlreiche weitere Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung. Die Bäuerinnen setzen sich kontinuierlich dafür ein, dass die Landwirtschaft einen festen Platz im Schulunterricht und in der Gesellschaft erhält. Mit diesen Schulaktionstagen möchten die Bäuerinnen nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch die Begeisterung für eine bewusste und regionale Ernährung fördern und den Kindern einen wertvollen Einblick in die Welt der Landwirtschaft geben.
Download
Kontakt für Rückfragen
Abteilung Agrarkommunikation der Landwirtschaftskammer NÖ
Tel.: +43(0)5 0259 28000, E-Mail: agrarkommunikation(at)lk-noe.at
Sorgen wir für gutes Klima. Schauen wir gemeinsam drauf, wo unser Essen herkommt.
Die heimischen Bäuerinnen und Bauern liefern verlässlich eine Vielfalt hochwertiger Lebensmittel und nachhaltiger Rohstoffe. Darüber hinaus erbringen sie einen immensen Mehrwert für unser Land. Die Landwirtschaftskammer NÖ will auf die Herkunft unseres Essens aufmerksam machen und setzt mit der Herbstkampagne „Verlass di drauf!“ 2023 einen neuerlichen Schwerpunkt, um den Wert der bäuerlichen Arbeit sichtbar zu machen und schließlich mehr Wertschöpfung zu erzielen. „Für uns in der Landwirtschaft ist die Transparenz der Herkunft der Lebensmittel – im Handel und in der Außerhausverpflegung – seit Jahren eine zentrale Forderung. Auch neun von zehn Konsument:innen wünschen sich das“, so Johannes Schmuckenschlager, Präsident der Landwirtschaftskammer NÖ.
Wer auf regionale Produkte setzt, schont das Klima
Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Die Lebensmittelproduktion und die damit verbundenen Umweltauswirkungen spielen dabei eine entscheidende Rolle. Doch Lebensmittelproduktion ist nicht gleich Lebensmittelproduktion. Wie unterscheidet sich der Klima-Fußabdruck regionaler Lebensmittel aus Österreich zu importierten Produkten und welche Bedeutung hat dabei die heimische Landwirtschaft?
Österreich kann sich bei vielen Produkten selbst bzw. überwiegend selbst versorgen. Um die Versorgungssicherheit zu erhöhen, ist es wichtig, die Produktion abzusichern. Dazu gehört unter anderem, bewusst regionale Erzeugnisse einzukaufen. Denn wer kauft, bestimmt, was produziert wird. Im Supermarktregal wird eine Vielzahl an billigen Lebensmitteln angeboten. Diese kommen allerdings häufig von weit her. Hier drängt sich die Frage auf, warum diese importierten Produkte so billig sind. Der Grund dafür sind die global sehr unterschiedlichen Produktions-, Umwelt- und Sozialstandards. „Die österreichischen Bäuerinnen und Bauern arbeiten unter strengsten Qualitätsauflagen, die strikt und laufend kontrolliert werden. Zudem sind unsere Betriebsstrukturen im internationalen Vergleich kleiner und daher kostenintensiver. Die höheren Produktionsstandards in Österreich verursachen höhere Preise. Umso wichtiger ist es, dass die hohe heimische Qualität entsprechend honoriert wird“, erklärt Schmuckenschlager. Der bewusste Kauf von regionalen Produkten hat zahlreiche positive Auswirkungen, betont der Kammerpräsident: „Wer zu heimischen Lebensmitteln greift, erhöht die Versorgungssicherheit und verhindert lange Transportwege, wodurch Emissionen verringert werden und der CO2-Fußabdruck deutlich reduziert wird. Zudem kann dadurch jede und jeder Einzelne dazu beitragen, Arbeitsplätze zu sichern und die Wertschöpfung in der Region zu halten. Bei importierten Waren, die noch dazu ohne genaues Wissen über die dortigen Standards eingeführt werden, sind wir von all diesen positiven Effekten weit entfernt.“
Die Vorteile heimischer Lebensmittel
- Nur 1 % weniger Importe von Agrarrohstoffen hätte bei gleichbleibender Nachfrage nach diesen Rohstoffen eine Steigerung der Wertschöpfung von 70 Mio. Euro zur Folge. Dies bedeutet für Österreich die Auslastung von 2.100 Beschäftigten.
- Nur 1 % weniger Importe von Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren würde die Wertschöpfung um weitere 70 Mio. Euro erhöhen und die Beschäftigung um 1.000 Personen ansteigen lassen.
Neuer Schwerpunkt in der Herbstkampagne 2023
Die im Herbst 2019 gestartete, mehrjährig angelegte Kampagne „Niederösterreichs Bauern. Eine Kammer. Verlass di drauf!“ will mit realen Botschaften den Wert der bäuerlichen Arbeit sichtbar machen und so Vertrauen ausbauen. Mit der Herbstkampagne „Verlass di drauf!“ 2023 setzt die Landwirtschaftskammer NÖ erneut einen medialen Schwerpunkt. Dieses Jahr steht das Thema Klimaschutz durch regionale Lebensmittel und Herkunftskennzeichnung im Fokus der Kampagne. Botschafter sind in bewährter Weise echte Bäuerinnen und Bauern mit dem ganz klaren Versprechen „Verlass di drauf!“.
Download
Kontakt für Rückfragen
Abteilung Agrarkommunikation der Landwirtschaftskammer NÖ
Tel.: +43(0)5 0259 28000, E-Mail: agrarkommunikation(at)lk-noe.at
Erster Kulturlandschaftsverein Niederösterreichs im Lainsitztal gegründet
Extensive, schwer zu bewirtschaftende und zugleich naturschutzfachlich hochbedeutsame Lebensräume werden zunehmend aus der Bewirtschaftung genommen, verbrachen, verbuschen und verlieren damit an landwirtschaftlicher wie auch naturschutzfachlicher Relevanz. Dieser Entwicklung will Niederösterreich gezielt gegensteuern. Im Zentrum steht dabei die Etablierung von regionalen Kulturlandschaftsvereinen (KLV). Nun wurde der erste Kulturlandschaftsverein in der Kleinregion Lainsitztal im westlichen Waldviertel gegründet. Niederösterreich nimmt damit einmal mehr eine Vorreiterrolle ein.
Kulturlandschaftsverein? Was ist denn das?
Die Ziele der regoinalen KLV sind:
- Erhalt und Entwicklung einer naturschutzfachlich wertvollen und regionaltypischen Kulturlandschaft mit all den national und europaweit geschützten Lebensräumen und Arten. Insbesondere das naturschutzfachlich wertvolle Offenland, wie Magerrasen, Trockenrasen, Quellen, Moore, Sumpfflächen, wird im Zentrum der Vereinsarbeit stehen.
- Regionalentwicklung durch Eröffnen, Bestärken bzw. Erweitern von Betriebsstandbeinen und Einkommensquellen für Landwirt:innen, durch Aufbau von Partnerschaften mit sonstigen regionalen Betrieben sowie durch Beiträge zum landschaftsbezogenen Naturtourismus
Das kleine Lainsitztal ganz groß
Die Kleinregion Lainsitztal besteht aus sechs Gemeinden: Marktgemeinde Bad Großpertholz, Marktgemeinde Großschönau, Gemeinde Moorbad Harbach, Marktgemeinde St. Martin, Gemeinde Unserfrau Altweitra und Stadtgemeinde Weitra. Diese haben sich 2004 zusammengeschlossen, um gemeindeübergreifend zusammenzuarbeiten. Seither arbeiten sie interkommunal im Interesse der Region zusammen, einen Schwerpunkt bildete dabei schon bisher der Bereich Umwelt, Energie und Naturschutz. Bei den KLVs sollen regionale Strukturen geschaffen werden, deren zentrale Aufgabe die Landschaftsentwicklung ist. Der KLV Lainsitztal hat sich zum Ziel gesetzt, dem Verlust von Lebensräumen und Artenvielfalt entgegenzuwirken und wichtige Impulse für die Regionalentwicklung zu setzen.
Download
Kontakt für Rückfragen
Abteilung Agrarkommunikation der Landwirtschaftskammer NÖ
Tel.: +43(0)5 0259 28000, E-Mail: agrarkommunikation(at)lk-noe.at
Weg zu mehr Regionalität in der öffentlichen Beschaffung
Warum werden Lebensmittel quer über den Kontinent transportiert? Und warum müssen alle Lebensmittel das ganze Jahr über verfügbar sein? Das fragen sich nicht nur die heimischen Bäuerinnen und Bauern sowie die Konsument:innen, sondern auch immer mehr Küchenchefs. Die Landwirtschaftskammer NÖ liefert auf diese Fragen regionale Antworten – und zwar mit der Initiative JA ZU NAH, im Rahmen derer nun eine rechtliche Toolbox für die Beschaffung regionaler Lebensmittel in Großküchen entwickelt wurde. Dieser Leitfaden soll dazu beitragen, den Anteil an Lebensmitteln aus der Region in Großküchen zu erhöhen.
Bäuerinnen und Bauern sind Teil der Energiewende
Nur ein Zusammenspiel aller verfügbaren erneuerbaren Energieträger kann die Versorgungssicherheit bringen, die wir brauchen - in Österreich und in Europa. Der ambitionierte Ausbau der Photovoltaik ist ein wichtiger Teil der Lösung. Mit dem Erneuerbare-Ausbau-Gesetz (EAG) sollen bis 2030 zusätzlich 27 TWh erneuerbarer Strom installiert werden, davon 11 TWh Photovoltaikstrom. Die Bäuerinnen und Bauern wollen ihren bestmöglichen Beitrag zum Ausbau der Photovoltaik leisten - und damit nicht nur die Energiewende umsetzen, sondern auch die Chancen für neue Wertschöpfungsmöglichkeiten nutzen. Immer unter der Prämisse der Versorgungssicherheit.
Status Quo: Außerhaus-Konsum steigt
In Österreich werden täglich rund 2,2 Mio. Essen in Großküchen und Kantinen konsumiert. Das ist rund ein Viertel der Bevölkerung, das zumindest einmal pro Tag dort verpflegt wird. Die Bedeutung und damit der Anteil der Verpflegung in Großküchen wird noch weiter zunehmen, da von einer steigenden Arbeitsquote auszugehen ist. Derzeit erfolgt die öffentliche Beschaffung zum überwiegenden Teil über österreichweit oder gar europaweit tätige Großhändler mit einem oft sehr eingeschränkten regionalen Sortiment. Mit der Lückenschlussverordnung und der ab 1. September geltenden Herkunftskennzeichnung in der Gemeinschaftsverpflegung ist bereits ein wichtiger Schritt in Richtung mehr Regionalität gelungen.
Potential in der öffentlichen Beschaffung
Wenn wir den Anteil an österreichischen Lebensmitteln in den Großküchen um 10 Prozent erhöhen, werden dadurch 500 landwirtschaftliche Betriebe abgesichert. Mit der Initiative JA ZU NAH – unter dem Dach der „Regionalen Lebensmittelkooperationen GmbH“ (kurz RLK) – hat die Landwirtschaftkammer einen neuen Absatzweg für die heimischen Bäuerinnen und Bauern zu den Großküchen aufgebaut. JA ZU NAH ist ein digitaler Lebensmittel-Marktplatz, mit dem Großküchenleiter:innen regionale und saisonale Produkte verschiedener bäuerlicher Betriebe aus der Region zusammengefasst beziehen können. Eine wichtige Rolle, die Regionalität in diesem Bereich zu steigern, kommt öffentlichen Auftraggebern zu, die Großküchen betreiben. Um die regionale Beschaffung direkt von den bäuerlichen Familienbetrieben für öffentliche Auftraggeber attraktiver zu machen und insbesondere zu erleichtern, hat die Landwirtschaftskammer NÖ daher die Erarbeitung einer rechtlichen Toolbox für die Beschaffung regionaler Lebensmittel in Großküchen initiiert.
Rechtliche Toolbox unterstützt bei öffentlicher Beschaffung
Der Leitfaden soll dazu beitragen, den Anteil an Lebensmitteln aus der Region in Großküchen zu erhöhen. In der Landwirtschaftskammer beschäftigt man sich schon längst mit neuen Möglichkeiten der Vermarktung von landwirtschaftlichen Produkten, denn nicht nur Endverbraucher, sondern auch Großküchen haben einen zunehmenden Bedarf an gesicherten regionalen Lebensmitteln. Allerdings sind deren Anforderungen beim Einkauf völlig andere als von Privathaushalten. Mit der rechtlichen Toolbox soll ein Schulterschluss zwischen Landwirtschaft und Großküchen geschaffen werden, um gemeinsam regionale Versorgungssicherheit, Krisenvorsorge und Klimaschutz weiter zu fördern. Für die Bäuerinnen und Bauern entstehen damit neue, langfristige Absatzmöglichkeiten mit mehr Wertschöpfung, Großküchen beziehen transparente, klimafreundliche Lebensmittel aus der Region. Das ist eine Win-Win-Situation für alle – für die Landwirtschaft, die Großküchen und deren Kundschaft.

Download
Kontakt für Rückfragen
Abteilung Agrarkommunikation der Landwirtschaftskammer NÖ
Tel.: +43(0)5 0259 28000, E-Mail: agrarkommunikation(at)lk-noe.at
Der Leitfaden „Rechtliche Toolbox für die Beschaffung von regionalen Lebensmitteln für Großküchen“ steht hier zum Download bereit.
Landwirtschaftskammer NÖ steht für Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis
Die Landwirtschaftskammer Niederösterreich trägt durch die Leitung und Teilnahme an Forschungs- und Innovationsprojekten in den verschiedensten Bereichen wesentlich dazu bei, den Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis zu intensivieren. Ziel ist es, Erkenntnisse und Lösungsansätze für die bäuerlichen Betriebe nutzbar zu machen. Die Projektthemen erstrecken sich über alle Bereiche der Landwirtschaft und reichen vom Pflanzenbau bis zur Technik. Ein kürzlich abgeschlossenes Forschungsprojekt beschäftigt sich mit dem Knoblauchanbau in Österreich. Andere Projekte handeln von der Digitalisierung, Produktionssicherheit bei Zuckerrüben und Biodiversität.
Wissenschaft und Praxis braucht es für die Zukunft
Die Landwirtschaft ist ein unglaublich dynamischer Bereich, die Herausforderungen und Technologien ändern sich laufend - nicht nur, aber auch wegen dem Klimawandel. Daher engagiert sich die Landwirtschaftskammer NÖ in verschiedenen Forschungs- und Innovationsprojekten – mit sehr gutem Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis. Es geht dabei um die Entwicklung von Strategien und um praxistaugliche Lösungen für die Bäuerinnen und Bauern. Damit soll den Betrieben geholfen werden, noch besser auf die geänderten Bedingungen in der Bewirtschaftung und neue Herausforderungen reagieren zu können.
Projekt Knoblauch
Der Knoblauchanbau in Österreich ist für viele landwirtschaftliche Betriebe in der östlichen Region zu einem wichtigen Standbein geworden. Ursprünglich zur Selbstversorgung gedacht, haben sich in den letzten Jahren immer mehr Betriebe auf den Knoblauchanbau spezialisiert. Die Intensivierung führte jedoch zu Krankheiten, insbesondere der Knoblauchzwiebel. Dies veranlasste Bäuerinnen und Bauern, zusammen mit Expert:innen aus Forschung, Verbänden und Bildung, ein landesweites Projekt zur Untersuchung von Schaderregern und Vermeidungsstrategien im Knoblauchanbau zu initiieren. Dabei konnten neue Erkenntnisse, insbesondere über die Grünfäule und eine bisher in Österreich unbekannte Fusariumart, die Trockenfäule verursacht, gewonnen werden. Da die Möglichkeiten des Pflanzenschutzes begrenzt sind, liegt der Schwerpunkt auf Sortenwahl, Pflanzgutqualität, Standortwahl und schonender Ernte- und Trocknungstechnik. Eine Broschüre dient als Leitfaden für den Knoblauchanbau in Österreich.
Projekt Digitalisierung
In der LK-Technik Mold liegt der Fokus auf praxistauglichen Lösungen durch moderne Technologien für eine nachhaltige Landwirtschaft. Dies wird im Rahmen des Innovationsprojekts Innovation Farm realisiert, bei dem die LK-Technik Mold einer der Standorte ist. Hier wird mit Hilfe von intelligenter Technik und Drohneneinsatz eine teilflächenspezifische Distelbekämpfung im Mais umgesetzt, wodurch 89 % Herbizid im Vergleich zur Ganzflächenbehandlung eingespart wurden.
Projekt Zuckerrübenproduktion
Im Rahmen des Projektes „Aufbau von Erhebungs- und Regulierungsmaßnahmen zu ausgewählten tierischen Schädlingen im Zuckerrübenanbau“ wurden wichtige Fragen zur Bekämpfung der Schaderreger Rübenderblaus, Blattläuse und Rübenerdfloh im heimischen Zuckerrübenanbau untersucht. Ein zentraler Aspekt war die Entwicklung eines umfassenden Larvenmonitorings für den Rübenerdfloh, um den möglichen Schädlingsdruck in den verschiedenen Anbaugebieten frühzeitig einschätzen zu können. Zusätzlich zum bestehenden Warndienst für Rübenblattkrankheiten wurde ein Warndienst für Rübenschädlinge eingerichtet. Die Projektergebnisse sind ein wichtiger Beitrag zur integrierten Schädlingsbekämpfung im heimischen Zuckerrübenanbau.
Projekt Biodiversität
Das Projekt Boden.Biodiversität untersucht die Vorteile einer bodenaufbauenden Bewirtschaftung für die Biodiversität des Bodenlebens und deren positive Auswirkungen auf den Pflanzenbau. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen in die Entwicklung von praxisorientierten Leitfäden und Arbeitsanleitungen ein, die Landwirt:innen dabei unterstützen sollen, ihre Böden fruchtbarer zu machen, indem sie die Biodiversität des Bodenlebens erhöhen. Um die Reichweite des Projekts zu steigern und eine breitere Zielgruppe anzusprechen, wird seit Projektbeginn die Arbeit der Versuchslandwirt:innen und Forscher:innen in den sozialen Medien auf Plattformen wie Instagram, Youtube und Facebook live dokumentiert. Zudem sind alle relevanten Informationen und Inhalte auf ihrer Website abrufbar.

Kontakt für Rückfragen
Abteilung Agrarkommunikation der Landwirtschaftskammer NÖ
Tel.: +43(0)5 0259 28000, E-Mail: agrarkommunikation(at)lk-noe.at
Kritische Zukunft für den Zucker
Die Produktionssicherung in der Land- und Forstwirtschaft muss oberste Priorität haben. Nur so kann eine sichere Versorgung mit heimischen Lebensmitteln gewährleistet werden. Um die Produktion und damit die Versorgung zu sichern, braucht es Rahmenbedingungen und Maßnahmen, die es den Bäuerinnen und Bauern ermöglichen, die angebauten Kulturen gesund zur Ernte zu bringen. Ein wesentlicher Teil praxistauglicher Lösungen ist ein wirksamer Pflanzenschutz. Das war deutlich zu sehen bei einem Lokalaugenschein der massiv geschädigten Zuckerrüben- und Kürbisflächen in Niederösterreich.
Fehlender Wirkstoff führt zu Ausfällen und mehr CO2
Der Rübenanbau wird in diesem Jahr durch ein stark erhöhtes Schädlingsaufkommen erheblich erschwert. Vielerorts verursacht der Rübenrüsselkäfer enorme Verluste - mehr als 5.000 Hektar Zuckerrüben mussten bereits umgebrochen werden. Das verursacht Mehrkosten von 2 Mio. Euro und 500 Tonnen zusätzlichen CO2-Ausstoß. Das entspricht 5 Millionen gefahrenen Autokilometern. Grund dafür ist das Fehlen eines wirksamen Beizmittels für Zuckerrübensaatgut, die Erhaltung der bisherigen Rübenanbaufläche wird dadurch massiv erschwert. Auch beim Kürbis ist die Situation prekär. Seit diesem Jahr gibt es kein ausreichend wirksames Beizmittel für Kürbissaatgut mehr - einer der Gründe für die enormen Ausfälle bei der diesjährigen Kürbisernte. Wie bei den Rüben sind auch beim Kürbis bereits mehrere tausend Hektar betroffen. Ganze Produktionszweige stoßen dadurch an ihre Grenzen.
Eigenversorgung der Menschen und nicht der Schädlinge fördern
Ziel jeder Entwicklung muss es sein, den Selbstversorgungsgrad mit österreichischen Produkten zu erhöhen, zumindest aber zu erhalten. Praxistaugliche Lösungen im Pflanzenschutz sind dabei unerlässlich. Nur durch die Zulassung und Verfügbarkeit wirksamer Pflanzenschutzmittel kann die Versorgung mit heimischen Lebensmitteln auch in Zukunft sichergestellt werden. Um das zu gewährleisten, muss die Europäische Union die Produktions- und Versorgungssicherheit in den Vordergrund stellen. Dafür braucht es zwei Maßnahmen: Der SUR-Verordnungsentwurf sei in der vorliegenden Form abzulehnen und die Möglichkeit der Notfallzulassung von Pflanzenschutzmitteln müsse erhalten bleiben. Die EU-Kommission wird auch darlegen müssen, wie in Europa künftig ein wettbewerbsfähiger Pflanzenbau abgesichert werden soll. Klar ist: Entweder produzieren wir in Europa oder wir importieren die Lebensmittel aus Übersee.
Der große Schaden
Auf den abgefressenen Rübenflächen hätten 60.000 Tonnen Zucker erzeugt werden, damit hätte ganz Wien ein Jahr lang versorgt werden können. Als Konsequenz kommt diese Menge jetzt wohl aus dem Ausland, wo dafür womöglich sogar Regenwald abgeholzt wird. Wir müssen uns die Frage stellen, ob wir weiterhin Produktion und Versorgungssicherheit inklusive Arbeitsplätze in Europa haben wollen. Denn derzeit läuft alles darauf hinaus, dass man die Lebensmittelproduktion aus Österreich und aus Europa verdrängen will. Wir brauchen eine radikale Wende: Wir müssen die Lebensmittelproduktion in Europa aufdrehen, anstatt sie abzudrehen. Für die Versorgungssicherheit und für die Umwelt

Download
Kontakt für Rückfragen
Abteilung Agrarkommunikation der Landwirtschaftskammer NÖ
Tel.: +43(0)5 0259 28000, E-Mail: agrarkommunikation(at)lk-noe.at
Bildungsangebot für Bienenwirtschaft und Imkerei
Niederösterreich ist das Naturland Nummer 1. Damit das auch so bleibt, ist es wichtig, auf die Insekten und vor allem die Bienen gut Acht zu geben. Die Landwirtschaft leistet dazu einen wesentlichen Beitrag – auch in der Bildung. Im Rahmen von „Landwirtschaft in der Schule“ besuchen pädagogisch ausgebildete Seminarbäuerinnen Schulklassen und geben spannende Einblicke in die Landwirtschaft. Im Workshop „Biene Maja und ihre wilden Verwandten“ gibt es jede Menge Wissenswertes über die Wild- und Honigbienen zu erfahren. Ebenso hat das Interesse an der Imkerei in den letzten Jahren stark zugenommen und die Bienenzüchter:innen werden immer jünger. Das zeigt die Absolventenzahl der Meister:innenausbildung: Es gibt 20 neue Imkermeister:innen. Auch die Imkerlehre liegt voll im Trend, daher wird das Bildungsangebot um einen eigenen Berufsschullehrgang für die Bienenwirtschaft erweitert.
Workshop für die Kleinsten mit „Biene Maja und ihre wilden Verwandten“
Wo leben Bienen? Was ist der Unterschied zwischen Honigbienen und Wildbienen? Welche Bedeutung haben Bienen für unsere Umwelt und unser tägliches Essen? Was kann ich selbst tun, um Wildbienen zu fördern? Speziell geschulte Seminarbäuerinnen kommen in die Schule und gehen im Workshop „Biene Maja und ihre wilden Verwandten“ genau auf diese und viele weitere Fragen ein. Die Seminarbäuerinnen informieren mit hoher Kompetenz zahlreiche Konsument:innen über den Wert unserer regionalen Produkte und geben einen authentischen Einblick in die Landwirtschaft. Mit spannenden Lehrmaterialien und interaktiven Methoden werden die Kinder aktiv eingebunden und lernen alles rund um Bienen, vor allem Wildbienen. Damit beginnen Sie bereits bei den Jüngsten. Bis Mai 2023 wurden in Niederösterreich 98 Bienen-Schulstunden mit 1.572 Kindern abgehalten.
Imkerlehre voll im Trend
Die naturverbundene Arbeit mit den Bienen sowie das Know-how rund um die Imkerei haben stark an Attraktivität gewonnen. Vielen ist nicht bekannt, dass man Imker:in auch als Beruf erlernen kann und damit den Facharbeiter:innenbrief im Beruf Bienenwirtschaft erhält. Die Ausbildung zur/m Facharbeiter:in im Beruf Bienenwirtschaft kann klassisch über die duale Ausbildung, sprich Lehre, in drei Lehrjahren erlernt bzw. auch im zweiten Bildungsweg absolviert werden. Per 1. Jänner 2023 waren allein in Niederösterreich 16 Lehrlinge in anerkannten Imker-Lehrbetrieben beschäftigt. Ab dem Schuljahr 2023/24 soll nun ein eigener Berufsschullehrgang für die Bienenwirtschaft in Kooperation zwischen den Landwirtschaftlichen Fachschulen Edelhof und Warth angeboten werden.
Kontakt für Rückfragen
Abteilung Agrarkommunikation der Landwirtschaftskammer NÖ
Tel.: +43(0)5 0259 28000, E-Mail: agrarkommunikation(at)lk-noe.at
Weitere Infos zu den verschiedenen Aus- und Weiterbildungsterminen und zur Anmeldung sind auf www.lehrlingsstelle.at verfügbar bzw. auch per Telefon unter 05 0259 26400 zu erfragen
Nutzung der Potenziale in der Land- und Forstwirtschaft für die Photovoltaik
Eine funktionierende und nachhaltige Energieversorgung ist für den Wohlstand unserer Gesellschaft unverzichtbar. Strom, Wärme und Mobilität sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Um Klimaneutralität zu erreichen, müssen alle Potenziale optimal genutzt werden - aus Wind und Sonne ebenso wie aus Wasser und Biomasse. Die Land- und Forstwirtschaft will und kann dazu einen wesentlichen Beitrag leisten. Das gilt auch für den Ausbau der Photovoltaik. Hier sind die Prioritäten klar: Vorrang haben Dachflächen. Aber auch gebäude- und betriebsintegrierte Photovoltaikanlagen haben ein großes Potenzial!
Bäuerinnen und Bauern sind Teil der Energiewende
Nur ein Zusammenspiel aller verfügbaren erneuerbaren Energieträger kann die Versorgungssicherheit bringen, die wir brauchen - in Österreich und in Europa. Der ambitionierte Ausbau der Photovoltaik ist ein wichtiger Teil der Lösung. Mit dem Erneuerbare-Ausbau-Gesetz (EAG) sollen bis 2030 zusätzlich 27 TWh erneuerbarer Strom installiert werden, davon 11 TWh Photovoltaikstrom. Die Bäuerinnen und Bauern wollen ihren bestmöglichen Beitrag zum Ausbau der Photovoltaik leisten - und damit nicht nur die Energiewende umsetzen, sondern auch die Chancen für neue Wertschöpfungsmöglichkeiten nutzen. Immer unter der Prämisse der Versorgungssicherheit.
Dachflächen den Vorrang geben
Vorrangig ist, das große Potenzial an Dachflächen zu nutzen. Ertragreiche Acker- und Grünlandflächen müssen für die Nahrungsmittelproduktion zur Verfügung stehen und von Photovoltaikanlagen freigehalten werden. Nur so kann das Spannungsfeld Energie- und Nahrungsmittelproduktion mit der Raumplanung in Einklang gebracht werden. Bei Vorhaben an der Oberfläche sind vorbelastete Flächen (z.B. Kiesgruben, Lagerplätze), Gewerbebrachen und Sonderstandorte mit geringster Bonität, die nicht oder nur nur bedingt für die Nahrungsmittelproduktion geeignet sind, den Vorrang zu geben. Wo es sinnvoll und möglich ist, kann auch die Mehrfachnutzung von extensiv bewirtschafteten Agrarflächen, d.h. sowohl für die Nahrungsmittel als auch für die Ökoenergieproduktion, überlegt werden. Beispielsweise bei der Kombination von Weidenutzung und Photovoltaik. Ein weiteres Ziel muss sein, unsere bäuerlichen Betriebe auch als aktive Partner an Photovoltaik-Projekten mit guten Wertschöpfungseffekten in der Land- und Forstwirtschaft zu beteiligen. Eine Möglichkeit dazu können zukünftig etwa Erneuerbare Energiegemeinschaften bieten.
Sallingstadt - die Vorzeigestadt
Sallingstadt hat rund 90 Wohnhäuser und rund 260 Einwohner. Derzeit gibt es hier 14 Voll- und Nebenerwerbslandwirte. Auf 28 Häusern ist eine Photovoltaik-Anlage installiert. 11 Anlagen davon liegen auf aktiv wirtschaftenden landwirtschaftlichen Betrieben. Die gesamte Modulfläche ist auf Dächern installiert – es gibt keine Freifläche.
Kontakt für Rückfragen
Abteilung Agrarkommunikation der Landwirtschaftskammer NÖ
Tel.: +43(0)5 0259 28000, E-Mail: agrarkommunikation(at)lk-noe.at
21. Laubholzversteigerung
177 Waldbauern und Forstbetriebe nahmen an der 21. Laubholzversteigerung in Heiligenkreuz teil. Die derzeit guten Rahmenbedingungen im Laubholzbereich zeigen, dass sich der respektvolle Umgang, das Engagement und die Kompetenz bei der Waldbewirtschaftung bezahlt machen. So war die diesjährige Wertholzversteigerung ein voller Erfolg mit ausgezeichnetem Ergebnis. Trendholz Nummer eins ist nach wie vor die Eiche. Das zeigt auch das höchste Gebot pro Festmeter – dieses erhielt eine Eiche mit 3.392 Euro.
Treffpunkt für Holzexperten aus dem In- und Ausland
Die Qualität des angebotenen Holzes wird weiter über die österreichischen Grenzen hinaus geschätzt. Die Versteigerung ist längst zu einem wichtigen Treffpunkt für Holzexpert:innen aus dem In- und Ausland geworden. So konnten dieses Jahr 36 Käufer aus Österreich, Deutschland, Tschechien, Ungarn, Slowenien und der Schweiz begrüßt werden.
Trendholz Eiche und Nuss
Die Wertholzversteigerung zeigt, dass Laubhölzer in hoher Qualität ständig gefragt sind. Der Trend zu dunklem Holz hält an. Dies machte sich dieses Jahr bei den angebotenen Holzarten deutlich bemerkbar. Den Hauptteil des heuer zu vermarktenden Holzes machte die Eiche aus. Sie war die gefragteste Baumart. Ebenso stark nachgefragt waren die Schwarznuss und die Walnuss sowie die Elsbeere.
Kontakt für Rückfragen
Abteilung Agrarkommunikation der Landwirtschaftskammer NÖ
Tel.: +43(0)5 0259 28000, E-Mail: agrarkommunikation(at)lk-noe.at
Erlebnis Bauernhof wird erweitert
„Erlebnis Bauernhof“ zählt zu den erfolgreichsten Bildungsinitiativen im landwirtschaftlichen Bereich. Das Angebot ist vielfältig und bietet zertifizierte Exkursions- und Unterrichtsangebote rund um das Thema Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion für Schulen und Kindergärten. Nun wurde das Angebot um die Teichwirtschaft erweitert. Im März 2023 startete die Ausbildung zur Teichrangerin bzw. zum Teichranger.
Was Teichranger:innen alles können
Ziel ist es, Führungen vor Ort an Teichen mit fachlich und pädagogisch geschulten Rangerinnen und Rangern anzubieten. Die Landwirtschaftskammer NÖ hat daher in Zusammenarbeit mit der KLAR! Region Waldviertel Nord und dem NÖ Teichwirteverband den Zertifikatslehrgang „Teichranger:in“ konzipiert, der im März 2023 erstmals startete.
Wieso das Wissen zu Teichen so wichtig ist
Die Teichwirtschaft ist ein wichtiger und traditioneller Teil unserer Heimat Niederösterreich. Die Teiche dienen nicht nur der Produktion heimischer Speisefische, sondern sind darüber hinaus natürlich auch ein wichtiger ökologischer Faktor. Mehr über die Teiche und die Teichwirtschaft zu wissen, heißt auch sie besser zu erhalten und wertzuschätzen. Um hinter die landwirtschaftlichen Kulissen zu blicken und den Weg der Lebensmittel zu erforschen und die damit verbundenen Klima- und Ökosystemdienstleistungen, haben es sich die niederösterreichischen Bäuerinnen und Bauern zum Ziel gemacht, diese Einblicke auch für die Jüngsten der Gesellschaft erfahr- und erlernbar zu machen.
Kontakt für Rückfragen
Abteilung Agrarkommunikation der Landwirtschaftskammer NÖ
Tel.: +43(0)5 0259 28000, E-Mail: agrarkommunikation(at)lk-noe.at