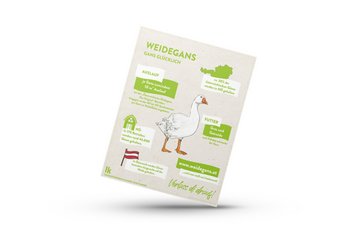Am 11. November ist Martinstag. Es wird Gansl gegessen und ein Laternenumzug gestartet. Die frühe Christenheit begann mit dem Martinstag die vierzigtägige Fastenzeit bis vor Weihnachten. Am letzten Tag vor der Fastenzeit konnten die Menschen noch einmal schlemmen. Daneben war der Martinstag auch der traditionelle Tag des Zehnten. Die Steuern wurden früher in Naturalien bezahlt, auch in Gänsen, da die bevorstehende Winterzeit das Durchfüttern der Tiere nur in einer eingeschränkten Zahl möglich machte.
Heiliger Martin
Wie der Heilige Martin zu den Gänsen kam
Gern wird erzählt, dass es seinen Ursprung in einer Legende über Martins Leben habe: Entgegen seinem eigenen Willen und trotz Vorbehalts des Klerus drängte das Volk von Tours darauf, Martin zum Bischof zu weihen. Asketisch und bescheiden, wie er sein Leben führte, hielt er sich unwürdig für solch eine große Verantwortung, und deshalb habe er sich in einem Gänsestall versteckt. Die Gänse jedoch hätten so aufgeregt geschnattert, dass Martin gefunden wurde und geweiht werden konnte. Eine andere Geschichte besagt, dass eine schnatternde Gänseschar in den Kirchraum gewatschelt sei und dabei Bischof Martin bei seiner Predigt unterbrochen habe. Sie wurde gefangen genommen und zu einer Mahlzeit verarbeitet. Aus dieser Legende entstand der Brauch des traditionellen Martinigansls. Viel wahrscheinlicher als dies Legende ist der Umstand, dass in Zeiten des Lehenswesens eine am Martinstag fällige Lehenspflicht, eine Abgabe namens Martinsschoß, der Ursprung war. Da diese häufig aus einer Gans bestand, bildete sich die Bezeichnung Martinsgans heraus, und weil der Martinstag traditionell mit einer Kirmes oder einem Tanzmusikabend gefeiert wurde, bot es sich an, die Gans zum Festessen zu machen und an diesem Abend festlich zu verspeisen.
 © Eva Lechner/LK NÖ
© Eva Lechner/LK NÖ Sankt-Martins-Zug bzw. -Umzug
Zum Tag des Heiligen Martin haben sich mehrere Bräuche bis in die heutige Zeit erhalten. Der Festtag begann früher mit einer Andacht am Vorabend, dem Lucernarium das „Zeit des Lampenanzündens“ heißt. Wahrscheinlich entwickelten sich aus diesem Lucernarium die Lichterumzüge, die Licht ins Dunkel bringen sollen. Wurden ehemals die Laternen aus Kürbissen hergestellt, basteln die Kinder heutzutage ihre phantasievollen Laternen meist aus Karton, Buntpapier und einer Kerze. Genauso wie die leuchtenden Laternen sind auch die Martinslieder bedeutend für die Umzüge. In manchen Ortschaften wird auch die Legende, mit dem Heiligen Martin der hoch zu Ross seinen Mantel mit einem Bettler teilt, nachgespielt. Der Laternenbrauch könnte auch aus dem Jahresablauf der Bauern wurzeln: Da zu Novemberbeginn der Abend früher dämmert, wird auch Licht und Feuer wichtiger für die Menschen. Zugleich beendeten die Bauern ihre Arbeit auf den Feldern und entzündeten darauf ein Feuer zum Dank für die Ernte. An dem Feuer entzündeten damals die Kinder „Trullichter“ aus ausgehölten Kürbissen oder Fackeln aus Stroh und Papier. Mit diesen Lichtern zogen sie dann durch das Dorf um Obst und Gebäck zu erbitten. Seit Jahren basteln und verzieren die Kinder, in den Volksschulen und Kindergärten bereits Tage zuvor, liebevoll ihre Papierlaternen mit denen sie dann am 11. November bei Einbruch der Dunkelheit in Prozessionen durch den Ort ziehen und singen: „Ich geh‘ mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Dort oben leuchten die Sterne und unten da leuchten wir ...“
 © canva
© canva Martiniloben
Meist sind Mitte November die Kellerarbeiten soweit abgeschlossen und der “junge” Wein wird getauft und gelobt – ab jetzt darf man auch beim Jungwein “Prost” sagen. Nach dem “Martiniloben” darf der erste Schluck des jungen Weines verkostet werden. Der Hl. Martin ist der Patron der Winzer:innen und wird in vielen Weinbaugemeinden gefeiert.
 © canva
© canva