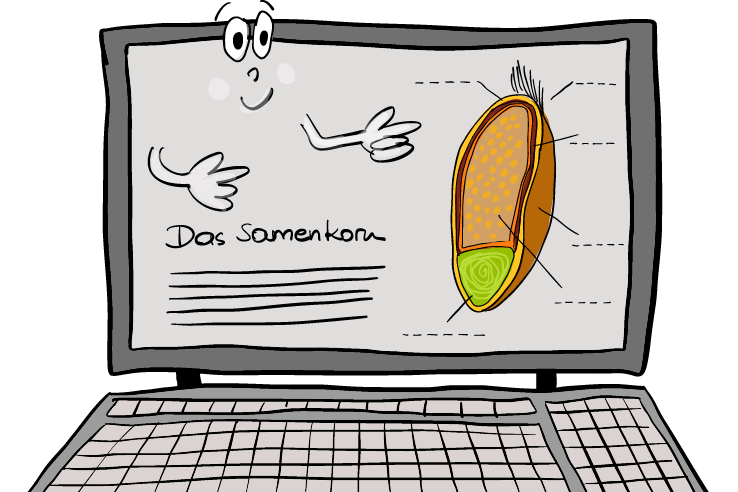Redewendungen
Ausdrücke und Sprüche, die ihren Ursprung in der Landwirtschaft haben
Viele Redewendungen, die wir heute ganz selbstverständlich benutzen, stammen ursprünglich aus der Landwirtschaft. Doch was steckt eigentlich dahinter, wenn wir “in den sauren Apfel beißen müssen” oder “die Spreu vom Weizen trennen”? In diesem Lernspiel gehen die Kinder auf Spurensuche: Sie entdecken Redewendungen mit bäuerlichen Wurzeln, lernen ihre Bedeutung kennen und erfahren dabei spielerisch, wie eng unsere Sprache mit dem Leben am Bauernhof verbunden ist.
Wer kennt die Bedeutung oder Herkunft dieser Redewendungen?
Bedeutung: Sich auf jemanden hundertprozentig verlassen können; jemand, mit dem man auch Schwieriges oder Verrücktes machen kann.
Herkunft: Diese Redewendung ist seit dem 17. Jahrhundert belegt. Früher wurden Pferde als kostbarer Besitz und wertvolle (Arbeits-)Tiere streng bewacht und Pferdediebe sehr hart bestraft. Wollte man also damals Pferde stehlen, brauchte man einen treuen und mutigen Freund, auf den man sich absolut verlassen konnte.
 © canva
© canva  © canva
© canva Bedeutung: Wer zuerst da ist, bekommt auch zuerst etwas.
Herkunft: Dieses Sprichwort kommt aus dem Mittelalter. Früher mussten sich die Bauern mit ihrem Getreide vor der Mühle anstellen und ihnen wurde dann nacheinander das Korn gemahlen. Wer zuerst da war, hat sein Mehl natürlich auch als erstes wieder bekommen und konnte eher wieder nach Hause gehen, während die Bauern, die später kamen, umso länger warten mussten.
 © canva
© canva
Bedeutung: Jemand ist streng, arrogant oder unfreundlich.
Herkunft: Dieses Sprichwort stammt aus dem Mittelalter. Kirschen waren früher eine teure Delikatesse, die sich nur Reiche leisten konnten. Reiche Leute trafen sich, wenn die Kirschen reif waren, zum gemeinsamen Kirschenessen. Wenn sie jedoch einen uneingeladenen Gast oder jemanden, der nicht so reich war wie sie, in ihrer Runde entdeckten, bespuckten sie diese Menschen so lange mit Kirschkernen, bis sie flüchteten.
 © canva
© canva Bedeutung: Etwas Unangenehmes, aber oft Notwendiges tun; sich überwinden (müssen); ein notwendiges Übel akzeptieren (müssen)
Herkunft: Diese Redewendung ist schon Jahrhunderte alt, aber die Herkunft nicht ganz genau belegt.
 © Drobot Dean/stock.adobe.com
© Drobot Dean/stock.adobe.com Bedeutung: Alles ist in Ordnung, es gibt keine Probleme.
Herkunft: Zerbrechliche Waren wie Glas oder Porzellan wurden im Mittelalter für den Transport in Butter gegossen. So überstanden sie die Reise unbeschadet.
 © canva
© canva Bedeutung: Trotz mangelnder Kompetenz oder unklugen Verhaltens auch mal Glück oder Erfolg haben. Das Gelingen einer Sache durch Zufall.
Herkunft: Hühner scharren mit den Füßen auf dem Boden um Fressbares zu finden. Der Ausdruck “auch ein blindes Huhn” weist darauf hin, dass es sich bei dieser Redewendung um einen Glücksfall handelt.
 © Philipp Monihart/LK NÖ
© Philipp Monihart/LK NÖ Bedeutung: Etwas nahezu Unmögliches -mit wenig Aussicht auf Erfolg - suchen.
Herkunft: Dieser redensartliche Vergleich ist seit dem 19. Jahrhundert belegt, wahrscheinlich aber älter.
 © canva
© canva  © canva
© canva Jemandem reinen Wein einschenken
Bedeutung: Jemandem ohne Umschweife/Ausflüchte die (unangenehme) Wahrheit sagen, ehrlich sein.
Herkunft: Diese Redewendung kommt aus dem Mittelalter. Damals verdünnten die Gastwirte den Wein oft mit Wasser oder essigsaurer Tonerde. Nur diejenigen, die nicht betrogen und ihren Gästen reinen Wein einschenkten, galten als ehrlich.
 © canva
© canva Den Kopf in den Sand stecken
Bedeutung: Eine drohende Gefahr, eine bevorstehende unangenehme Arbeit nicht sehen wollen, also ignorieren.
Herkunft: Hat ein Straußenvogel Gefahr vernommen, so senkt er den Kopf nah über den Boden und sieht für den Feind wie ein Busch aus. Für Beobachteter, sieht es so aus, als stecke der Vogel den Kopf in den Sand.
 © BMLRT/Alexander Haiden
© BMLRT/Alexander Haiden Bedeutung: Wenn jemand “den Wald vor lauter Bäumen” nicht sieht, dann bemerkt er etwas vollkommen Offensichtliches nicht oder erkennt die nächstliegende Lösung seines Problems vor lauter Auswahlmöglichkeiten nicht.
Bedeutung: Sich ungeschickt verhalten, einen Fauxpas begehen;
Herkunft: Früher stand in Bauernhäusern oft kleine Näpfe mit Fett, um Lederstiefel zu pflegen. Wer versehentlich hineintrat oder den Napf umstieß, sorgte für Ärger.
 © canva
© canva  © canva
© canva Bedeutung: Jemandem schmeicheln.
Herkunft: Die bekannteste Erklärung für diese Redewendung stammt aus dem Bereich Zirkus – in früheren Jahrhunderten wurde für die Dressur von Bären Honig genutzt, der den Tieren nach gelungenen Übungen als Belohnung oder davor als Ansporn ums Maul geschmiert wurde.
 © canva
© canva Bedeutung: Der Morgen ist die beste Zeit, um eine Arbeit zu beginnen. Wer frühmorgens mit dem Arbeiten beginnt, schafft mehr.
Herkunft: Schon in alter Zeit war klar: Wer zeitig aufsteht, nutzt den kühlen Morgen am besten. So gehen etwa Winzer an heißen Tagen besonders früh in den Weingarten, um die Mittagshitze zu meiden.
Sich eine Eselsbrücke bauen
Bedeutung: Sich eine Merkhilfe schaffen, um sich etwas leichter einzuprägen.
Herkunft: Esel wurden früher bei uns als Lasttiere eingesetzt. Sie sind oft sehr sture Tiere. Manche weigerten sich, beim Überqueren von Gewässern durch das Wasser zu gehen. Damit sie trotzdem ans Ziel kamen, baute man ihnen kleine Brücken – sogenannte „Eselsbrücken“.
 © canva
© canva Sich ins Zeug legen
Bedeutung: Sich anstrengen, mit vollem Einsatz arbeiten.
Herkunft: Das Geschirr von Pferden wird auch als Zeug bezeichnet. Früher wurden Pferde oder Ochsen bei uns zum Ziehen von Wägen oder des Pfluges eingesetzt. Legten sich die Tiere mit ihrem ganzen Gewicht ins Geschirr, kamen Wagen und Pflug richtig voran. Deshalb steht diese Redewendung für Engagement und harte Arbeit.
 © canva
© canva Kennst du noch mehr Redewendungen?
Weißt du vielleicht, woher "Stroh im Kopf haben" oder “Etwas geht auf keine Kuhhaut” bedeutet?